Batteriespeicher bieten eine Vielzahl von Systemdienstleistungen, die zur Frequenz- und Spannungshaltung dienen und für den zukünftigen Betrieb der Stromnetzte essenziell sind, an.
Im Gegensatz zu einer Sonnenfinsternis, die exakt vorher zu sagen ist, sind die Prognosen für Wind- und Sonnenkraft nur sehr kurzfristig und weniger verlässlich. Eine 24-Stunden-Vorhersage erreicht heutzutage eine Eintreffgenauigkeit von gut 90 Prozent. Die Treffsicherheit für die kommenden drei Tage beträgt nur noch etwas mehr als 75 Prozent.
Damit diese fehlende Verlässlichkeit ausgeglichen und die konstante Netzfrequenz gehalten werden kann, treffen die Netzbetreiber mehrere Sicherungsmaßnahmen. Ein zentrales Instrument dieser Maßnahmen sind die Netzdienstleistungen, die darüber hinaus auch eine noch bessere Integration von erneuerbaren Energien aus Sonnen- und Windkraft ermöglichen. Ein Beispiel für diese Netzdienstleistungen ist das Aufnehmen und Abgeben von Regelleistung zur Stabilisierung der Stromversorgung.
„Regelleistung gleicht Schwankungen der Netzfrequenz aus“
Bei der Regelleistung, oder auch Regelenergie genannt, kann dabei in drei Qualitätsstufen unterschieden werden:
Die Primär-, Sekundär- und Tertiärregelung. Diese sogenannte Ausgleichsenergie wird durch Batterien bereitgestellt, nimmt Strom aus dem Netz auf und / oder gibt sie wieder in das Netz ab. Schwankungen können dadurch ausgeglichen werden. Alle drei unterscheiden sich danach, wie schnell, wie viel und wie lange sie die 50 Hertz Frequenz ausgleichen müssen.

Der große Vorteil von Großspeichern ist, dass diese sekundenschnell reagieren können - schneller als jede andere Technologie. Außerdem können sie sowohl überschüssige Energie speichern als auch gespeicherte Energie zur Verfügung stellen. Die Speicher funktionieren also in beide Richtungen.
Eine weitere Form der Netzdienstleistungen sind Redispatch-Maßnahmen. Das sind notwendige Eingriffe in die Stromproduktion, um die fehlenden Übertragungsnetze auszugleichen. Anders ausgedrückt versteht man unter Redispatch Eingriffe in die Erzeugungsleistung von Kraftwerken, um einer Überlastung von Leitungsabschnitten vorzubeugen. Je nach Auslastung durch EE-Anlagen, sind die Redispachtmaßnahmen höher. Studien geben darüber einen sehr guten Einblick und können die Auswirkungen des weiteren Zubaus an EE-Anlagen sehr gut darstellen.
Batteriespeicher werden somit zukünftig einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Netze beitragen und durch Redispatch-Maßnahmen fehlenden Übertragungsnetze ausgleichen.
Zusätzlich zu den o.a. beschriebenen Diensten, bieten Batteriespeicher die Bereitstellung von Blindleistung an. Gemäß der VDE-Norm 0100-710 bezieht sich Blindleistung auf diejenige elektrische Leistung, die zwischen den Phasenleitern und dem Neutralleiter eines Drehstromnetzes hin- und herfließt, jedoch nicht in der Lage ist, mechanische Arbeit zu verrichten. Sie wird in Volt-Ampere-Reaktiv (VAR) gemessen. Einfacher ausgedrückt muss 50-mal pro Sekunde ein Magnetfeld auf- und abgebaut werden damit Strom im Wechselstromnetz überhaupt fließen kann. Weil die Leistung zum Aufbau eines Feldes bei dessen Abbau wieder ans Netz zurückgegeben wird, bezeichnet man diese Leistung als Blindleistung. Blindleistung ist also essentiell, damit Strom überhaupt „fließen“ kann.
Übertragungsnetzbetreiber haben generell Interesse an Blindleistung und sehen diesbezüglich einen wichtigen Beitrag der Batteriespeicher. Hintergrund ist, dass durch die schrittweise Stilllegung konventioneller Kraftwerke zunehmend situativ Mangelsituationen in der Bereitstellung von Blindleistung eintreten werden.
Der Bedarf an Blindleistung, zur Versorgung der Allgemeinheit mit Strom, ist somit eindeutig und wird durch Batteriespeicherprojekte sichergestellt.
Ohne Batteriespeicher, die in der Lage sind, diese Dienstleistungen zu 100% anzubieten, wäre die Allgemeinheit mit Blackouts, Netzengpässe und Stromausfällen konfrontiert.
Netzbetreiber dürfen die o.a. beschrieben Dienste gem. Energiewirtschaftgesetz (EnWG) nicht selber anbieten. Man spricht in diesem Zusammenhang von dem sogenannten Begriff des Unbundling (zu Deutsch: Entflechtung) der die gesetzliche Forderung nach einer Trennung von Netz und Vertrieb bei Energieversorgungsunternehmen beschriebt. Ziel ist ein neutraler Netzbetrieb – wie es auch im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vorgeschrieben ist.
D.h., ohne Batteriespeicher, die von der Privatwirtschaft investiert werden, können die Netzbetreiber die Netze für die Allgemeinheit nicht stabil halten. Eine Kooperation zwischen Netzbetreiber und uns / Investoren ist somit zwingend notwendig.
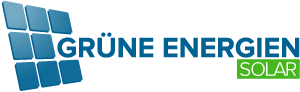
 Deutsch
Deutsch  English
English 